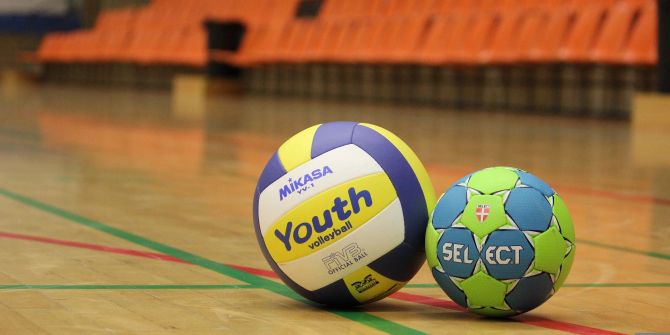Linkes Genf überholt bürgerliches Zug – Experte ordnet ein

Genf dürfte im Finanzausgleich bald am meisten einzahlen. Ein Experte erklärt den Erfolg des Westschweizer Kantons – man müsse aber auch relativieren.

Das Wichtigste in Kürze
- Im Schweizer Finanzausgleich gibt es einen neuen Spitzenreiter.
- Genf zahlt bald am meisten in den Topf ein – und überholt damit Zug.
- Je nachdem, wie man die Zahlen anschaut, sieht es für Genf aber weniger gut aus.
Es ist eine Premiere: Der Kanton Genf dürfte 2028 erstmals am meisten in den Finanzausgleich einzahlen. Möglich macht es der Gewinn von 541 Millionen Franken im Jahr 2024 – das beste Ergebnis aller 26 Kantone.
Damit überholt der westlichste Landesteil laut den Prognosen den bisherigen Spitzenreiter Zug. 2025 zahlten die Innerschweizer am meisten in den Topf ein. Nun wird aller Voraussicht nach ein Vertreter aus der Romandie folgen.
Ausgerechnet, könnte man sagen. In Abstimmungen stimmt die Westschweiz oft eher links ab als die Deutschschweiz. In vielen Köpfen schwirrt das Klischee der «linken» oder sogar «faulen» Romandie herum.
Wie kann es sein, dass Genf jetzt den Kanton aus der «bürgerlichen» und «tüchtigen» Innerschweiz überholt?
Genfer Wirtschaft floriert – aber es gibt Herausforderungen
Marco Portmann vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern erklärt gegenüber Nau.ch: «Die Genfer Wirtschaft florierte in den letzten Jahren breit abgestützt.»
Mehrere Bereiche entwickelten sich laut dem Experten positiv: der Rohstoff- und Warenhandel, der Finanzsektor oder auch die Luxusgüter- und Uhrenbranche. Die Einnahmen sprudelten daneben auch bei den natürlichen Personen.
Ob der Trend anhält, ist fraglich. «Bei den Unternehmen zeichnet sich eine Abschwächung ab», sagt Portmann.

Der Experte nennt mehrere Herausforderungen, die auch auf die Genfer Unternehmen zukommen. Unter anderem der US-Zollkrieg oder politische Rahmenbedingungen wie die OECD-Mindeststeuer könnten sich negativ auswirken.
Genf steigt zum stärksten Zahler auf, aber ...
Zumindest für den Moment ist Genf in jedem Fall an der finanziellen Spitze der Kantone. Wobei auch diese Platzierung laut Portmann relativiert werden muss.
So kann man die totalen Zahlungen in den Finanzausgleich mit der Bevölkerungszahl ins Verhältnis setzen. «2025 zahlt Zug pro Einwohner 3350 und Schwyz 1570 Franken in den Finanzausgleich. Wenn die Prognose stimmt, zahlt Genf 2026 rund 1180 Franken pro Einwohner.»

Beim Finanzausgleich pro Kopf dürfte das deutlich kleinere Zug also immer noch auf Platz eins liegen.
Zudem muss man zwischen dem Ressourcenausgleich und dem Lastenausgleich unterscheiden, so Portmann. Bei ersterem steige Genf zwar zum grössten Zahler auf. Bei zweiterem erhalte Genf jedoch Zahlungen von 160 Millionen Franken – «so viel wie kein anderer Kanton».
Beim Ressourcenausgleich geht es darum, dass jeder Kanton genügend Mittel hat, um seine Aufgaben wahrzunehmen. Finanzstarke Kantone zahlen ein, finanzschwache Kantone bekommen Geld.
Der vom Bund finanzierte Lastenausgleich unterstützt Kantone, die überdurchschnittliche Kosten tragen müssen, die sie nicht beeinflussen können. Das sind beispielsweise Kosten aufgrund der Bevölkerungsstruktur.
Im Falle Genf geht es vor allem um Integrations- und Armutslasten. «Diese Zahlungen sind in einer Gesamtbetrachtung mit einzubeziehen», ist für Portmann klar.
Gute Zahlen: Linke Mehrheiten eher Folge als Ursache
In der Stadt Genf verteidigte Linksgrün kürzlich seine Regierungsmehrheit. Ist es also die linke Wirtschaftspolitik, die die Calvinstadt und ihre Umgebung finanziell gut dastehen lässt?
Laut Marco Portmann ist der Zusammenhang eher in die andere Richtung zu sehen: «Hohe Steuereinnahmen wecken ausgabenseitige Begehrlichkeiten. Das ist ein demokratisch legitimer Zusammenhang, der sich in vielen wirtschaftsstarken Städten beobachten lässt.»

Man muss natürlich auch festhalten, dass es kantonsweit etwas anders aussieht als in der Stadt Genf.
Im Staatsrat hat die FDP zwei, die SP zwei und die Grünen einen Sitz. Dazu kommt der Ex-FDP-Mann Pierre Maudet, der ebenfalls eher dem bürgerlichen Lager zuzurechnen ist.
Linksgrün und Rechtsbürgerliche haben in diesem ausgeglichen besetzten Gremium also jeweils drei Sitze. Sitz Nummer sieben besetzt die Mitte.
Die aktuelle Lage biete jedenfalls unabhängig der politischen Mehrheiten gute Chancen, in die Wettbewerbsfähigkeit zu investieren. «Dazu gehören nicht zuletzt Entflechtungen im Finanzausgleich», führt Portmann aus.
Gegenläufige Zahlungen im Finanzausgleich
Ein Beispiel für problematische Verflechtungen, das der Experte nennt: «Im Finanzausgleich bestehen im Ressourcen- und Lastenausgleich gegenläufige Zahlungsströme.»
Das heisst: Finanzstarke und urbane Kantone wie Genf erhalten Geld aus dem Lastenausgleich. Dieser wird durch den Bund, unter anderem mit Steuern aus finanzschwächeren Kantonen, finanziert.
Gleichzeitig unterstützten Genf und Co. finanzschwächere Kantone über den Ressourcenausgleich.

Wenn widersprüchliche Ausgleichszahlungen zwischen Bund und Kantonen abgebaut werden, fördere dies die Kostenwahrheit. «Dies fördert die effiziente Verwendung von Steuereinnahmen», sagt Portmann.
Kürzlich haben die Behörden das Projekt «Entflechtung 27» lanciert. Dieses soll eben die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen genauer unter die Lupe nehmen.
Ein Vorhaben, das zu begrüssen sei, findet Portmann. Auch wenn es noch zu früh für eine ausführliche Beurteilung sei.